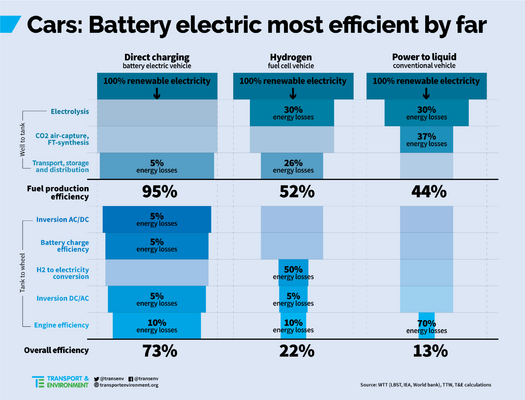Die höchste Leistungsdichte bietet die permanenterregte Synchronmaschine, wie sie beispielsweise bei Porsche im Einsatz ist. In einem solchen Motor sorgen magnetische Materialien im Rotor für eine Drehbewegung, sobald der Stator mit Wechselstrom beschickt wird. Sobald die Nennleistung erreicht ist, muss jedoch das Magnetfeld aktiv geschwächt werden, was den Wirkungsgrad bei hohen Drehzahlen verschlechtert. Zudem ist die permanente Erregung mit erheblichem Ressourceneinsatz verbunden. Denn in einem einzelnen 140-Kilowatt-Motor befinden sich rund zwei Kilo Magnetmaterial, unter anderem die seltenen Erden Neodym und Dysprosium. Kostengünstiger sind daher die weitverbreiteten Asynchronmaschinen, in denen in den Windungen des Rotors ein Stromfluss induziert wird. Insbesondere bei niedrigen Drehzahlen ist der Wirkungsgrad deutlich schlechter als bei permanenterregten Motoren.
Eine dritte Alternative besteht darin, als Rotor einen Elektromagneten einzusetzen, also eine einzelne Spule, in der sich ein ferritischer Kern befindet. Diese sogenannte fremderregte Synchronmaschine, auf die der Renault Zoe setzt, besticht – verglichen mit der Asynchronmaschine – durch einen deutlich höheren Wirkungsgrad, da nur ein bis drei Prozent der Gesamtleistung für die Rotorerregung benötigt werden. Der Maschinentyp hat bislang allerdings einen wesentlichen Nachteil: Der für die Magnetisierung notwendige Strom fließt über Schleifkontakte in den Rotor. Was schleift, erzeugt Reibung und Verschleiß. Mahle hat nun einen Weg gefunden, den Strom kontaktlos zu übertragen. Dafür kommt ein kleiner Drehtransformator zum Einsatz, der fest mit dem Stator verbunden ist. Eine zweite Wicklung, auf die der Strom induktiv übertragen wird, befindet sich auf der Rotorseite. Das Bauteil selbst ist unscheinbar und kaum größer als eine Kaffeetasse. Und doch liegt in der Ansteuerung erhebliches Fertigungswissen: Übertragen wird nämlich per Wechselstrom, so kann die Motorleistung über eine Phasenverschiebung geregelt werden. Der auf der Rotorseite ankommende Strom wird dann wieder in den vom Elektromagneten benötigten Gleichstrom gewandelt.
Die auftretenden Verluste sind gering. Das von Mahle veröffentlichte Kennfeld zeigt einen Wirkungsgrad von mehr als 94 Prozent nicht nur im besten Punkt, sondern über einen weiten Drehzahlbereich. „Dadurch kann man, unabhängig vom persönlichen Fahrprofil, eine höhere Reichweite erzielen“, erläutert Martin Berger, Forschungschef des Unternehmens. Da viele Autohersteller ihre Elektromotoren selbst bauen wollen, bietet Mahle nicht nur den Komplettmotor an, sondern will den induktiven Leistungsüberträger auch als separates Zulieferbauteil verkaufen. „Das wäre dann die Kurbelwelle für den Elektromotor“, sagt Berger. Bis der Motor in einem ersten Serienauto Einzug hält, dürften jedoch noch Jahre ins Land gehen.
In der Zwischenzeit fährt die große Masse der Elektroautos mit fremderregten Asynchronmaschinen, im Premiummarkt greift man auch gern zum permanenten Magneten. Immer an Bord, aber vom Autofahrer selten bemerkt, ist ein Getriebe. Mit wenigen Ausnahmen handelt es sich dabei um eine simple Ein-Gang-Übersetzung. Sie hält die Motordrehzahl in jenem Bereich, der durch gängige Testzyklen abgedeckt wird. Wer sich knapp unterhalb der Autobahn-Richtgeschwindigkeit bewegt und dann zum Überholen das Fahrpedal durchdrückt, spürt, dass da etwas fehlt. Grund dafür ist ein wesentliches Merkmal der gängigen Elektromotoren: Bis zu einer bestimmten Drehzahl, auch Eckpunkt genannt, steigt die Leistung linear, das Drehmoment ist bis dahin konstant hoch. Doch jenseits des Eckpunkts nimmt die Leistung nicht mehr zu, das Drehmoment folglich ab, und der Fahrer hofft, wie in einem freisaugenden Diesel der Achtzigerjahre, dass er keinen Schwung verliert. Abhilfe würde ein zweiter oder gar dritter Gang schaffen.
Vor diesem Hintergrund hat Bosch ein Konzept für ein stufenloses Getriebe entwickelt, das speziell für Elektrofahrzeuge gedacht ist. Es hält den Motor, unabhängig von der Fahrgeschwindigkeit, immer in einem Kennfeldbereich, in dem das volle Drehmoment abgerufen werden kann. Trotzdem soll der Stromverbrauch sinken, um rund drei bis vier Prozent in einem Personenwagen, bei Elektrolieferwagen sogar um bis zu zehn Prozent. „Aktuelle Elektroantriebe stellen immer einen Kompromiss dar“, erläutert Dirk van den Heuvel. Er arbeitet für Bosch im niederländischen Tilburg, wo einst DAF die Variomatic entwickelte, den Urvater aller stufenlosen Getriebe. Die Mehrkosten, die der Einsatz eines solchen Getriebes verursachen würde, beziffert van den Heuvel auf nur zwei bis drei Prozent, weil die Batterie kleiner ausfiele und weniger stark gekühlt werden müsste. „Gegebenenfalls kann man auch einen kleineren Motor einsetzen“, sagt er.