Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden.
Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
WDR 3 Studio Elektronische Musik - Allgemeines & Zukunft des historischen Studios
- Ersteller 7f_ff
- Erstellt am
-
- Schlagworte
- köln stockhausen studio für elektronische musik volker müller wdr
bohor
|||
Ich kann dir zumindest sagen, wie das User Interface dazu aussah: Die wichtigste Möglichkeit war nach meinem Wissen die 'Mühle' – ich nehme an, das Ding, was in den Skizzen rechts unten ("B") zu sehen ist: Da konnte eine Klangquelle per kurbelnder Drehbewegung auf je einen von acht Lautsprecher geschaltet werden. Also, man dreht die Kurbel langsam und dann immer schneller… Ich bin bisher davon ausgegangen, dass die acht Lautsprecher dazu jeweils frei bestimmt werden konnten; wenn ich die Zeichnung des Schaltplans (oben in #309) sehe, bin ich aber gar nicht mehr sicher. Diesen Effekt hat Stockhausen natürlich in jedem Stück einmal ausgenutzt (diese Information hab ich von einem, der dabei war).mich würde ja mal interessieren, welche techniken man 1970 eigentlich benutzt hat um in diesem raum quellen zu bewegen.
Steht das so in den Texten? Meines Wissens hat er gar kein Stück ausdrücklich für diesen Raum komponiert; ganz sicher keins, das nur dort aufgeführt werden sollte oder konnte.[...] "Stockhausens erste Skizze zu einer speziell für das Kugelauditorium konzipierten Komposition" [...]
Dirk
|||||||||||
einseinsnull
[nur noch PN]
Du kannst dir das Buch auch in einer Bibliothek ausleihen.
du könntest es mir als gute nacht geschichte vorlesen.
Dort fanden, so wie ich schon geschrieben hatte, live-elektronische Aufführungen statt.
du hast natürlich recht: das setup war sicher nicht immer gleich.
Die wichtigste Möglichkeit war nach meinem Wissen die 'Mühle'
hm, das wäre dann im prinzip schon fast das, was ich oben beschrieben habe, ein linearer, endloser, crossfader. natürlich nur 2d und ohne breite.
bin grad ein bischen enttäuscht, dass die kugel unten nicht ganz rund ist und da auch weniger lautsprecher sind als oben.
auch dass die zuschauer nicht möglichst genau in der mitte plaziert wurden irritiert mich.
dirigenten müssen sich immer so wichtig machen! dabei fuchteln die doch nur mit den armen das nach, was die violinen gerade vorspielen.
Zuletzt bearbeitet:
Dirk
|||||||||||
Für Kreis-, Spiral- und andere periodische Bewegungsformen verwendete ich eine >Rotationsmühle<. Irgendein Mikrophon oder ein Gemisch von Mikrophonen konnte man auf den Eingang einer solchen Mühle legen (Stockhausen zeichnet das Schema der Rotationsmühle an die Tafel); die Mühle hatte zehn elektrische Ausgänge, die man mit beliebigen 10 der 50 Lautsprecherkanäle verbinden konnte, und wenn man mit der Hand den Steuerhebel wie eine Kaffeemühle links oder rechts herum drehte, bewegte sich der Klang entsprechend im Raum. Die höchste Geschwindigkeit betrug ungefähr fünf Perioden pro Sekunde. Mit Drucktastenknöpfen konnte man dann noch das Klanggemisch während der Bewegung ändern. Wenn also zum Beispiel ein Sänger auf diese Weise über Lautsprecher projiziert wurde, war es, als wenn sich ein Mensch unsichtbar im Raum bewegt.
Vier Kriterien der Elektronischen Musik von Karlheinz Stockhausen
Die vier Kriterien der Elektronischen Musik von Karlheinz Stockhausen
www.elektropolis.de
einseinsnull
[nur noch PN]
Dirk
|||||||||||
SPIRAL für einen Solisten (1968)
(geschrieben Januar 1970)
In SPIRAL werden Ereignisse, die ein Solist mit einem Kurzwellenradio empfängt, imitiert, transformiert und transzendiert.
Außer dem Radio kann er ein beliebiges Instrument, mehrere Instrumente, Instrument und Stimme, oder nur die Stimme benutzen.
Zur räumlichen Projektion und Verstärkung von Instrument, Stimme und Kurzwellenklängen benötigt er Mikrophone und wenigstens zwei Lautsprecher.
Die Lautsprecher können von einem Assistenten geregelt werden, um das Verhältnis von Direktklang und Lautsprecherklang musikalisch zu gestalten.
SPIRAL ist eine Folge von Ereignissen, die durch verschieden lange Pausen getrennt werden. Ein Ereignis wird entweder gleichzeitig mit KW-Empfänger UND Instrument/Stimme realisiert, oder NUR mit Instrument/Stimme. Das erste Ereignis muß mit KW-Empfänger und Instrument/Stimme realisiert werden. Seine Dauer, Lage, Lautstärke, rhythmische Gliederung sind relativ frei.
Einem KW-Ereignis soll sich das gleichzeitige Instrumentale/Vokale so angleichen, daß es mit ihm verschmilzt.
Vom zweiten Ereignis ab ist der Wechsel von Ereignissen mit oder ohne KW-Empfänger frei; es soll jedoch ein ausgewogenes Verhältnis der Ereignisse mit und ohne KW-Empfang angestrebt werden.
Für das zweite und jedes weitere Ereignis bestimmt der Solist Dauer, Lage, Lautstärke und rhythmische Gliederung gemäß der fortlaufenden Reihenfolge von Transformationszeichen, die in einer Partitur notiert sind.
Alle anderen Eigenschaften - Klangfarbe, Proportionen der rhythmischen Glieder, Melodik, Harmonik, vertikale Schichtung usw. -, die sich aus einem KW-Ereignis ergeben, sollen mit Instrument/Stimme so genau wie möglich imitiert werden; sie werden von Ereignis zu Ereignis möglichst beibehalten, bis sie sich durch ein neu gewähltes KW -Ereignis erneuern. Beim Suchen eines Kurzwellenereignisses soll man leise von Sender zu Sender wechseln, bis man etwas gefunden hat, was den notierten Verhältnissen der Tonhöhenlagen entspricht. Darüber hinaus aber ist für die Wahl entscheidend, daß der Solist eine möglichst breite Skala zwischen konkreten und abstrakten Klangereignissen in einer Interpretation anstrebt und sich immer der nächsten Transformation bewußt ist, die er mit diesem Ereignis durchzuführen hat. Er soll bei einzelnen Sendern verschieden lange verweilen, und auch das Suchen sollte immer musikalisch artikuliert sein.
Außer einfachen Transpositionen (wie höher - tiefer, länger - kürzer, leiser - lauter, mehr Glieder - weniger Glieder) gibt es noch besondere Transformationen: Ornamentierung, polyphone Artikulation, periodische Gliederung, Echos, 'Erinnerungen', 'Ankündigungen', Permutation von Gliedern, lange bandförmige Verdichtungen von Elementen, akkordische Raffungen, Spreizungen, Stauchungen.
Ab und zu kommt eine Transformation vor, die dieser Prozeß-Komposition den Namen SPIRAL gab:
»Wiederhole das vorige Ereignis mehrmals,
transponiere es jedesmal in allen Bereichen
und transzendiere es über die Grenzen
deiner bisherigen Spiel-/Gesangstechnik
und dann auch über die Begrenzungen
deines Instrumentes/deiner Stimme
hinaus.
Hierbei sind auch alle visuellen, theatralischen
Möglichkeiten angesprochen.
Behalte von nun an, was du in der
Erweiterung deiner Grenzen erfahren
hast, und verwende es in dieser und
allen zukünftigen Aufführungen von SPIRAL.«
Besitzt nicht nahezu jeder einen Kurzwellenempfänger? Und hat nicht jeder eine Stimme?
Wäre es nicht für jeden eine künstlerische Lebensform, das Unvorhergesehene, das man aus einem Kurzwellenradio empfangen kann, in neue Musik zu verwandeln, das heißt, in einen bewußt gestalteten Klangprozeß, der alle intuitiven, denkerischen, sensiblen und gestalterischen Fähigkeiten wachruft und schöpferisch werden läßt, auf daß sich dieses Bewußtsein und diese Fähigkeiten spiralförmig steigern?!
SPIRAL ist im September 1968 in Madison/Connecticut entstanden. Michael Lorimer, ein junger amerikanischer Gitarrist, kam im August 68 nach Darmstadt. Er hatte mich schon des öfteren um eine Komposition für Gitarre gebeten und wollte mir alle Möglichkeiten des Gitarrespiels und der bereits vorhandenen Kompositionen für Gitarre zeigen. Ich begann im September mit einer Komposition für Gitarre, kam aber einfach nicht voran, da ich nicht den nötigen Enthusiasmus hatte, bei jedem Akkord, bei jeder Passage die Fingerstellungen auszuprobieren. Endlich legte ich die Arbeit beiseite und begann mit der Komposition SPIRAL, die an die früheren Prozeß-Kompositionen PROZESSION und vor allem KURZWELLEN anknüpfte, und die sich - nach den Erfahrungen der ersten Aufführungen der Textkompositionen AUS DEN SIEBEN TAGEN - in den Anforderungen des Spiralzeichens an den Spieler auf metamusikalische Erfahrungen richtete.
Lorimer kam dann nach Madison, war höchst überrascht über das Resultat und auch wohl ein wenig enttäuscht, da er nach mehreren Tagen intensiven Übens das Stück "viel zu schwer" fand und , "lieber etwas Leichteres" gehabt hätte.
Die erste Aufführung spielte der Oboist Reinz Rolliger auf der Biennale in Zagreb im Mai 1969, und im Juni 1969 machte Michael Vetter (elektrische Blockflöte) die ersten Schallplattenaufnahmen.
Ergänzung Ende 1970:
Während der Weltausstellung EXPO 70 in Osaka, Japan, wurden täglich von 15.30 bis ca. 21.00 Uhr Werke Stockhausens von 20 Musikern im Kugelauditorium des Deutschen Pavillons für über 1 Million Zuhörer live aufgeführt.
Eines dieser Werke war SPIRAL, das mehr als 1300mal vom 14. März bis zum 14. September 1970 täglich in verschiedenen Versionen gespielt oder gesungen wurde.
Karlheinz Stockhausen – Texte zur Musik
Band 3, 1963-1970
(geschrieben Januar 1970)
In SPIRAL werden Ereignisse, die ein Solist mit einem Kurzwellenradio empfängt, imitiert, transformiert und transzendiert.
Außer dem Radio kann er ein beliebiges Instrument, mehrere Instrumente, Instrument und Stimme, oder nur die Stimme benutzen.
Zur räumlichen Projektion und Verstärkung von Instrument, Stimme und Kurzwellenklängen benötigt er Mikrophone und wenigstens zwei Lautsprecher.
Die Lautsprecher können von einem Assistenten geregelt werden, um das Verhältnis von Direktklang und Lautsprecherklang musikalisch zu gestalten.
SPIRAL ist eine Folge von Ereignissen, die durch verschieden lange Pausen getrennt werden. Ein Ereignis wird entweder gleichzeitig mit KW-Empfänger UND Instrument/Stimme realisiert, oder NUR mit Instrument/Stimme. Das erste Ereignis muß mit KW-Empfänger und Instrument/Stimme realisiert werden. Seine Dauer, Lage, Lautstärke, rhythmische Gliederung sind relativ frei.
Einem KW-Ereignis soll sich das gleichzeitige Instrumentale/Vokale so angleichen, daß es mit ihm verschmilzt.
Vom zweiten Ereignis ab ist der Wechsel von Ereignissen mit oder ohne KW-Empfänger frei; es soll jedoch ein ausgewogenes Verhältnis der Ereignisse mit und ohne KW-Empfang angestrebt werden.
Für das zweite und jedes weitere Ereignis bestimmt der Solist Dauer, Lage, Lautstärke und rhythmische Gliederung gemäß der fortlaufenden Reihenfolge von Transformationszeichen, die in einer Partitur notiert sind.
Alle anderen Eigenschaften - Klangfarbe, Proportionen der rhythmischen Glieder, Melodik, Harmonik, vertikale Schichtung usw. -, die sich aus einem KW-Ereignis ergeben, sollen mit Instrument/Stimme so genau wie möglich imitiert werden; sie werden von Ereignis zu Ereignis möglichst beibehalten, bis sie sich durch ein neu gewähltes KW -Ereignis erneuern. Beim Suchen eines Kurzwellenereignisses soll man leise von Sender zu Sender wechseln, bis man etwas gefunden hat, was den notierten Verhältnissen der Tonhöhenlagen entspricht. Darüber hinaus aber ist für die Wahl entscheidend, daß der Solist eine möglichst breite Skala zwischen konkreten und abstrakten Klangereignissen in einer Interpretation anstrebt und sich immer der nächsten Transformation bewußt ist, die er mit diesem Ereignis durchzuführen hat. Er soll bei einzelnen Sendern verschieden lange verweilen, und auch das Suchen sollte immer musikalisch artikuliert sein.
Außer einfachen Transpositionen (wie höher - tiefer, länger - kürzer, leiser - lauter, mehr Glieder - weniger Glieder) gibt es noch besondere Transformationen: Ornamentierung, polyphone Artikulation, periodische Gliederung, Echos, 'Erinnerungen', 'Ankündigungen', Permutation von Gliedern, lange bandförmige Verdichtungen von Elementen, akkordische Raffungen, Spreizungen, Stauchungen.
Ab und zu kommt eine Transformation vor, die dieser Prozeß-Komposition den Namen SPIRAL gab:
»Wiederhole das vorige Ereignis mehrmals,
transponiere es jedesmal in allen Bereichen
und transzendiere es über die Grenzen
deiner bisherigen Spiel-/Gesangstechnik
und dann auch über die Begrenzungen
deines Instrumentes/deiner Stimme
hinaus.
Hierbei sind auch alle visuellen, theatralischen
Möglichkeiten angesprochen.
Behalte von nun an, was du in der
Erweiterung deiner Grenzen erfahren
hast, und verwende es in dieser und
allen zukünftigen Aufführungen von SPIRAL.«
Besitzt nicht nahezu jeder einen Kurzwellenempfänger? Und hat nicht jeder eine Stimme?
Wäre es nicht für jeden eine künstlerische Lebensform, das Unvorhergesehene, das man aus einem Kurzwellenradio empfangen kann, in neue Musik zu verwandeln, das heißt, in einen bewußt gestalteten Klangprozeß, der alle intuitiven, denkerischen, sensiblen und gestalterischen Fähigkeiten wachruft und schöpferisch werden läßt, auf daß sich dieses Bewußtsein und diese Fähigkeiten spiralförmig steigern?!
SPIRAL ist im September 1968 in Madison/Connecticut entstanden. Michael Lorimer, ein junger amerikanischer Gitarrist, kam im August 68 nach Darmstadt. Er hatte mich schon des öfteren um eine Komposition für Gitarre gebeten und wollte mir alle Möglichkeiten des Gitarrespiels und der bereits vorhandenen Kompositionen für Gitarre zeigen. Ich begann im September mit einer Komposition für Gitarre, kam aber einfach nicht voran, da ich nicht den nötigen Enthusiasmus hatte, bei jedem Akkord, bei jeder Passage die Fingerstellungen auszuprobieren. Endlich legte ich die Arbeit beiseite und begann mit der Komposition SPIRAL, die an die früheren Prozeß-Kompositionen PROZESSION und vor allem KURZWELLEN anknüpfte, und die sich - nach den Erfahrungen der ersten Aufführungen der Textkompositionen AUS DEN SIEBEN TAGEN - in den Anforderungen des Spiralzeichens an den Spieler auf metamusikalische Erfahrungen richtete.
Lorimer kam dann nach Madison, war höchst überrascht über das Resultat und auch wohl ein wenig enttäuscht, da er nach mehreren Tagen intensiven Übens das Stück "viel zu schwer" fand und , "lieber etwas Leichteres" gehabt hätte.
Die erste Aufführung spielte der Oboist Reinz Rolliger auf der Biennale in Zagreb im Mai 1969, und im Juni 1969 machte Michael Vetter (elektrische Blockflöte) die ersten Schallplattenaufnahmen.
Ergänzung Ende 1970:
Während der Weltausstellung EXPO 70 in Osaka, Japan, wurden täglich von 15.30 bis ca. 21.00 Uhr Werke Stockhausens von 20 Musikern im Kugelauditorium des Deutschen Pavillons für über 1 Million Zuhörer live aufgeführt.
Eines dieser Werke war SPIRAL, das mehr als 1300mal vom 14. März bis zum 14. September 1970 täglich in verschiedenen Versionen gespielt oder gesungen wurde.
Karlheinz Stockhausen – Texte zur Musik
Band 3, 1963-1970
einseinsnull
[nur noch PN]
anstatt die mikrophone im raum zu drehen könnte man natürlich auch einfach die mikrophone fest aufstellen und den cellisten zirkulieren lassen.
nimmt man einen kunstkopf dafür, hat man auch gleich die auralfilterversion für den späteren genuss unter dem kopfhörer.

Frau Stockhausen zeigt dem Cellisten seinen neuen Arbeitsplatz.

Hauptsache das Mikrophon wird geschont.
nimmt man einen kunstkopf dafür, hat man auch gleich die auralfilterversion für den späteren genuss unter dem kopfhörer.

Frau Stockhausen zeigt dem Cellisten seinen neuen Arbeitsplatz.

Hauptsache das Mikrophon wird geschont.
Dirk
|||||||||||
Tomorrow Never Knows
Durch den ganzen Aufwand war die Sache mit Johns Gesang etwas ins Abseits geraten. Um ihn wie einen buddhistischen Mönch klingen zu lassen, sein damals sehnlichster Wunsch, schickten wir seine Stimme durch den Leslie-Lautsprecher unserer Hammondorgel. Ein Leslie-Lautsprecher rotiert innerhalb eines Lowryorgel-Gehäuses mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Mit Hilfe eines Pedals kann man diese Rotationen beschleunigen oder verlangsamen. Dadurch erzielt man eine Art Doppler- oder Wah-wah-Effekt. Wir ließen John 87 Sekunden lang durch den Leslie-Lautsprecher singen und nahmen den Gesang mit einem vor dem Lautsprecher platzierten Mikrophon auf. Dies erweckte genau jenen seltsamen Eindruck von einer Stimme, die irgendwie pulsiert und weit weg ist, wie er es sich gewünscht hatte. John war von dem Resultat dermaßen begeistert, daß Geoff Emerick vorschlug, das Ganze noch mal andersherum auszuprobieren. John an einem Seil aufzuhängen, so daß er frei schwebte, und beim Singen ihn anstelle des Lautsprechers zu drehen! Doch so weit wollte nicht einmal John gehen.
George Martin
Summer of Love – Wie Sgt. Pepper entstand
Henschel Verlag
Durch den ganzen Aufwand war die Sache mit Johns Gesang etwas ins Abseits geraten. Um ihn wie einen buddhistischen Mönch klingen zu lassen, sein damals sehnlichster Wunsch, schickten wir seine Stimme durch den Leslie-Lautsprecher unserer Hammondorgel. Ein Leslie-Lautsprecher rotiert innerhalb eines Lowryorgel-Gehäuses mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Mit Hilfe eines Pedals kann man diese Rotationen beschleunigen oder verlangsamen. Dadurch erzielt man eine Art Doppler- oder Wah-wah-Effekt. Wir ließen John 87 Sekunden lang durch den Leslie-Lautsprecher singen und nahmen den Gesang mit einem vor dem Lautsprecher platzierten Mikrophon auf. Dies erweckte genau jenen seltsamen Eindruck von einer Stimme, die irgendwie pulsiert und weit weg ist, wie er es sich gewünscht hatte. John war von dem Resultat dermaßen begeistert, daß Geoff Emerick vorschlug, das Ganze noch mal andersherum auszuprobieren. John an einem Seil aufzuhängen, so daß er frei schwebte, und beim Singen ihn anstelle des Lautsprechers zu drehen! Doch so weit wollte nicht einmal John gehen.
George Martin
Summer of Love – Wie Sgt. Pepper entstand
Henschel Verlag
oli
*****
Die DEGEM hat nun in ihrem NEWS-Bereich auch über die Vorgänge berichtet.
oli
*****
Im VAN Magazine wurde auch berichtet.
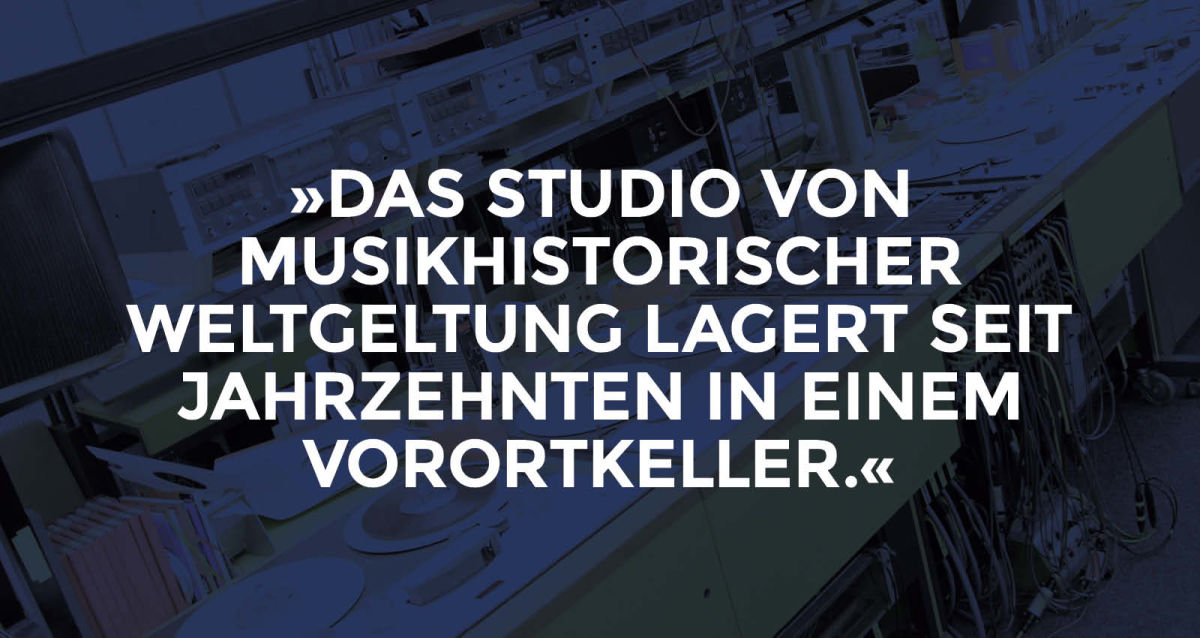
"Doch am 10. Januar dieses Jahres stellte sich nun – wiederum für alle überraschend – heraus, dass auch dieser Plan gescheitert ist. Unter der Überschrift »›Studio für elektronische Musik‹ ohne Zukunft« hieß es auf der Homepage von Haus Mödrath, der WDR habe nach fünf Jahren die letzte Annahmefrist kommentarlos verstreichen lassen. Der Sender sehe sich nicht in der Lage, das Studio zu betreiben, selbst wenn es mehrere Partner gebe und es »den WDR keinen einzigen Cent kosten würde«. Beim Telefonat klingt der anonyme Mäzen dann genauso verbittert wie sein Posting. »Es fehlt schlicht an Bereitschaft«, lautet sein Fazit. Lange habe man mit unterschiedlichen Institutionen verhandelt, unter anderem mit den Musikhochschulen des Landes, dem Amt für Denkmalpflege und der Stadt Köln, um eine Trägerstruktur zu schaffen, die die Wartung und den Betrieb des Studios übernimmt. Denn »ein totes Maschinenmuseum« hinter Glas wie in Mailand, das wolle niemand bei Apparaten, die immer noch einzigartige Klänge hervorbringen könnten und gerade heute, in Zeiten des Retro, von Spezialisten begehrte Unikate seien, siehe das Beispiel mit der Stradivari. Von Anfang an hoffte man, dass sich durch den Zusammenschluss von Institutionen und weiteren Investoren eine Lösung für die jährlichen laufenden Kosten von 200.000 bis 300.000 Euro finden lassen würde, die der anonyme Mäzen nicht übernehmen konnte und wollte. Nun, nach dem Scheitern aller Verhandlungen, sieht er vor allem den WDR in der Pflicht, für den das alte Studio in seinen Augen nur mehr ein Klotz am Bein sei. Auf schriftliche Anfrage widerspricht der Sender jedoch dieser Darstellung deutlich: »Der WDR hat dem Haus Mödrath keine Absage erteilt. Vielmehr ist es so, dass es trotz zahlreicher Gespräche mit möglichen Partnern bislang nicht gelungen ist, eine funktionierende Trägerschaft und damit eine langfristige Finanzierungsstruktur aufzubauen. Der WDR setzt sich weiterhin dafür ein, das ›Studio für elektronische Musik‹ in eine öffentliche Einrichtung zu übergeben und wird daher weitere Gespräche mit Interessenten führen.« Sprich: Ein konkreter Plan B existiert nicht. Eine weitere Mail übt sich in Optimismus: »Grundsätzlich ist das Studio sowohl für den wissenschaftlichen und dokumentarischen sowie in Grenzen auch für den produktionstechnischen Gebrauch nutzbar.«
Alles also halb so wild? Und was sagt der dazu, der wohl in den vergangenen zwanzig Jahren am meisten Zeit in dem Studio verbracht hat und es kennt wie kein anderer, Volker Müller? Einerseits sei er erleichtert über die Lösung in Mödrath gewesen, andererseits »gehört das Studio doch verdammt nochmal nach Köln!« Unvorstellbar sei es für ihn, sollte das Studio, wie es zuweilen heißt, an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz abgegeben werden. Für Müller ist aber das drängendste Problem ohnehin nicht der Standort. Die halbe Million Euro, die der Umzug und Aufbau für den WDR bedeutet hätten, seien sinnvoller verwendet, wenn man sie in die Instandhaltung der Geräte stecke. Es sei mittlerweile schwierig geworden, Ersatzteile für die alten Apparate zu beschaffen, weil viele der Herstellerfirmen gar nicht mehr existierten. Ein noch größeres Problem stelle aber das Wissen dar, das mit den wenigen, die noch aktiv mit den Geräten gearbeitet hatten, in absehbarer Zeit verloren gehe. So wenig Zukunft hatte die Zukunft von einst wohl noch nie.
Tatsächlich fragt man sich, was geschehen soll, wenn der mittlerweile über 77-jährige Müller eines nicht allzu fernen Tages sein Engagement für das Studio reduzieren oder aufgeben muss und sich die angespannte finanzielle Situation der öffentlich-rechtlichen Sender weiter zuspitzt. Und auch wenn es zwar viel Heroisches, aber keinen klaren Schuldigen in diesem Trauerspiel zu geben scheint, wundert man sich doch, wie es überhaupt so weit kommen konnte: Während aktuell verblüffend viele neue Museen für Schwindel erregende Millionensummen im Gespräch sind, vom Museum des 20. Jahrhunderts in Berlin bis zum Deutschen Fotoinstitut in Düsseldorf, lagert ein Studio von musikhistorischer Weltgeltung, ein Teil der kulturellen Identität dieses Landes, nun bereits seit Jahrzehnten in einem Vorortkeller?
Um es noch einmal mit Thomas Pynchon zu sagen: Ein Heulen kommt über den Himmel. "
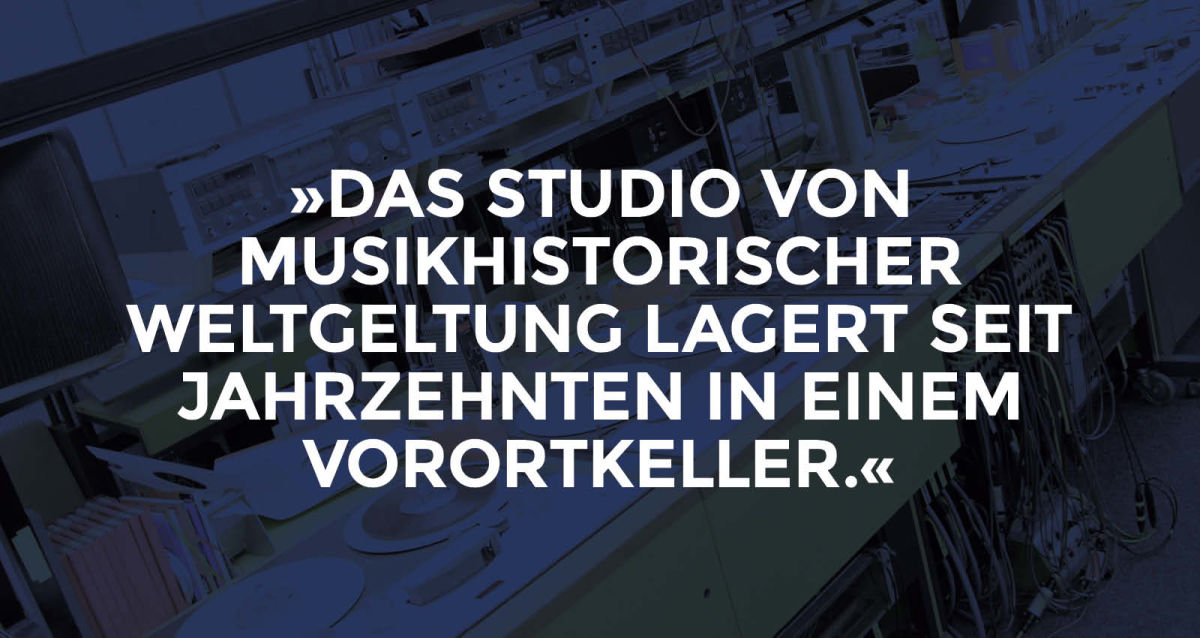
"Doch am 10. Januar dieses Jahres stellte sich nun – wiederum für alle überraschend – heraus, dass auch dieser Plan gescheitert ist. Unter der Überschrift »›Studio für elektronische Musik‹ ohne Zukunft« hieß es auf der Homepage von Haus Mödrath, der WDR habe nach fünf Jahren die letzte Annahmefrist kommentarlos verstreichen lassen. Der Sender sehe sich nicht in der Lage, das Studio zu betreiben, selbst wenn es mehrere Partner gebe und es »den WDR keinen einzigen Cent kosten würde«. Beim Telefonat klingt der anonyme Mäzen dann genauso verbittert wie sein Posting. »Es fehlt schlicht an Bereitschaft«, lautet sein Fazit. Lange habe man mit unterschiedlichen Institutionen verhandelt, unter anderem mit den Musikhochschulen des Landes, dem Amt für Denkmalpflege und der Stadt Köln, um eine Trägerstruktur zu schaffen, die die Wartung und den Betrieb des Studios übernimmt. Denn »ein totes Maschinenmuseum« hinter Glas wie in Mailand, das wolle niemand bei Apparaten, die immer noch einzigartige Klänge hervorbringen könnten und gerade heute, in Zeiten des Retro, von Spezialisten begehrte Unikate seien, siehe das Beispiel mit der Stradivari. Von Anfang an hoffte man, dass sich durch den Zusammenschluss von Institutionen und weiteren Investoren eine Lösung für die jährlichen laufenden Kosten von 200.000 bis 300.000 Euro finden lassen würde, die der anonyme Mäzen nicht übernehmen konnte und wollte. Nun, nach dem Scheitern aller Verhandlungen, sieht er vor allem den WDR in der Pflicht, für den das alte Studio in seinen Augen nur mehr ein Klotz am Bein sei. Auf schriftliche Anfrage widerspricht der Sender jedoch dieser Darstellung deutlich: »Der WDR hat dem Haus Mödrath keine Absage erteilt. Vielmehr ist es so, dass es trotz zahlreicher Gespräche mit möglichen Partnern bislang nicht gelungen ist, eine funktionierende Trägerschaft und damit eine langfristige Finanzierungsstruktur aufzubauen. Der WDR setzt sich weiterhin dafür ein, das ›Studio für elektronische Musik‹ in eine öffentliche Einrichtung zu übergeben und wird daher weitere Gespräche mit Interessenten führen.« Sprich: Ein konkreter Plan B existiert nicht. Eine weitere Mail übt sich in Optimismus: »Grundsätzlich ist das Studio sowohl für den wissenschaftlichen und dokumentarischen sowie in Grenzen auch für den produktionstechnischen Gebrauch nutzbar.«
Alles also halb so wild? Und was sagt der dazu, der wohl in den vergangenen zwanzig Jahren am meisten Zeit in dem Studio verbracht hat und es kennt wie kein anderer, Volker Müller? Einerseits sei er erleichtert über die Lösung in Mödrath gewesen, andererseits »gehört das Studio doch verdammt nochmal nach Köln!« Unvorstellbar sei es für ihn, sollte das Studio, wie es zuweilen heißt, an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz abgegeben werden. Für Müller ist aber das drängendste Problem ohnehin nicht der Standort. Die halbe Million Euro, die der Umzug und Aufbau für den WDR bedeutet hätten, seien sinnvoller verwendet, wenn man sie in die Instandhaltung der Geräte stecke. Es sei mittlerweile schwierig geworden, Ersatzteile für die alten Apparate zu beschaffen, weil viele der Herstellerfirmen gar nicht mehr existierten. Ein noch größeres Problem stelle aber das Wissen dar, das mit den wenigen, die noch aktiv mit den Geräten gearbeitet hatten, in absehbarer Zeit verloren gehe. So wenig Zukunft hatte die Zukunft von einst wohl noch nie.
Tatsächlich fragt man sich, was geschehen soll, wenn der mittlerweile über 77-jährige Müller eines nicht allzu fernen Tages sein Engagement für das Studio reduzieren oder aufgeben muss und sich die angespannte finanzielle Situation der öffentlich-rechtlichen Sender weiter zuspitzt. Und auch wenn es zwar viel Heroisches, aber keinen klaren Schuldigen in diesem Trauerspiel zu geben scheint, wundert man sich doch, wie es überhaupt so weit kommen konnte: Während aktuell verblüffend viele neue Museen für Schwindel erregende Millionensummen im Gespräch sind, vom Museum des 20. Jahrhunderts in Berlin bis zum Deutschen Fotoinstitut in Düsseldorf, lagert ein Studio von musikhistorischer Weltgeltung, ein Teil der kulturellen Identität dieses Landes, nun bereits seit Jahrzehnten in einem Vorortkeller?
Um es noch einmal mit Thomas Pynchon zu sagen: Ein Heulen kommt über den Himmel. "
Lauflicht
TR4ever
Bernie
|||||||||||||||
Das wäre nicht praxisorientiert und somit nicht zielführend.Was spricht denn gegen eine Website, wo alles genau und detailliert beschrieben wird? Ist das nicht zukunftssicher genug? Also das die mögliche Informationsmenge kostengünstig bestmöglich erhalten bleibt?
Man möchte ja den Musikstudenten die Arbeitsweisen näher bringen und dazu muss man real damit arbeiten können.
Moogulator
Admin
Diese Information liegt nicht allein in der Materie oder Daten. Das wäre wie die Schulbänke zu scannen und ins Netz zu stellen.Mir geht/ging es um den Erhalt von Information, mehr nicht. Was sollte wichtiger sein als das?
Moogulator
Admin
Natürlich nicht, denn gerade das WDR Studio f. Elektronische Musik besteht nicht aus OSCs, Synclavier und so weiter allein, auch aus Musik und Wissen, dieses sollte man weiter bringen und auch das Erlebnis und die Erkenntnisse davon. Das meinte ich. Das reicht weniger, wenn man zeigt - das hier ist ein DX7 und der hat 6 Operatoren. Das ist nicht, wie die Werke am Ende gebaut sind. Das ist "nur Technik", es geht aber um den Ansatz der Kompositionen und so weiter.
Die Musik online zu stellen ist sicher ohne Chance. Wäre toll, aber .. nunja..
Die Musik online zu stellen ist sicher ohne Chance. Wäre toll, aber .. nunja..
einseinsnull
[nur noch PN]
einseinsnull
[nur noch PN]
Lauflicht
TR4ever
Aber wie will man die Studiotechnik und die damit verbundene (historische) Arbeitsweise gut im WWW abbilden? Lehrvideos? Wer soll die dann machen? Das Studio ist in seinem Aufbau und Fähigkeiten einzigartig. Stockhausen hat sich das Studio so eingerichtet, wie es ihm für seine Arbeiten am besten passte (im Rahmen der damaligen, technischen Limitierungen). Man muss das als ganzes Organisches betrachten. Das ist ja das besondere daran. Ich denke, dass kann man nur begreifen, wenn man die Hardware sieht, anfasst und zu beherrschen lernt.
A
Altered States
Guest
Genau, man muss alles anfassen können um es zu begreifen, ganz wichtig. Irgendwer meinte mal man muss Dinge anfassen können, dann werde sie realer. Ist nicht meine Meinung, aber für manche vielleicht wichtig/notwendig... Ich denke, dass kann man nur begreifen, wenn man die Hardware sieht, anfasst und zu beherrschen lernt.
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
einseinsnull
[nur noch PN]
man kann doch alles gut im www abbilden.
die leute kaufen heute häuser, autos, frauen, einfach alles im www ohne es vorher angefasst zu haben.
wie soll sich ein drehknopf von 1968 schon anfühlen? total anders wie einer von 1985? eher nicht.
aber du hast recht, dass das zeugs zusammengehört. deswegen kann man das auch nicht dem deutschen museum in münchen überlassen, die stellen die geräte sonst einzeln in glasvitrinen aus - und die dazu passenden kabel kommen dann im nächsten raum.
die leute kaufen heute häuser, autos, frauen, einfach alles im www ohne es vorher angefasst zu haben.
wie soll sich ein drehknopf von 1968 schon anfühlen? total anders wie einer von 1985? eher nicht.
aber du hast recht, dass das zeugs zusammengehört. deswegen kann man das auch nicht dem deutschen museum in münchen überlassen, die stellen die geräte sonst einzeln in glasvitrinen aus - und die dazu passenden kabel kommen dann im nächsten raum.
Bernie
|||||||||||||||
Hast du denn schon mal etwas aus diesem WDR-Studio gehört?man kann doch alles gut im www abbilden.
die leute kaufen heute häuser, autos, frauen, einfach alles im www ohne es vorher angefasst zu haben.
wie soll sich ein drehknopf von 1968 schon anfühlen? total anders wie einer von 1985? eher nicht.
aber du hast recht, dass das zeugs zusammengehört. deswegen kann man das auch nicht dem deutschen museum in münchen überlassen, die stellen die geräte sonst einzeln in glasvitrinen aus - und die dazu passenden kabel kommen dann im nächsten raum.
Das ist durch die Mehrkanaltechnik ein ziemlich einzigartiger Genuss, das kann man nicht beschreiben.
Abgesehen davon gehören da auch die Kompositionen dazu und die Lösungen um sie zu realisieren.
Das muss man alles real erleben, das kann man nicht downloaden.
Es geht also nicht darum, nur irgendwelche Drehknöppe anzufassen.
einseinsnull
[nur noch PN]
ich finde das eine sehr enge sichtweise, dass die geräte ohne die kompositionen des meisters so gar keine bedeutung hätten.
das ist doch ein "studio" und kein konzertsaal, oder?
mein onkel günther war kunstmaler und graphiker, desen haus ist jetzt auch ein museum und man hat vieles so gelassen wie es ist.
aber die besucher fassen nicht die schablonen an und bekommen von einem kunstexperten live vorgeführt, wie man eine staffelei aufstellt oder wie man eine farbtube aufdreht.
das weiß doch jeder, der in so ein haus zu besuch kommt.
das ist doch ein "studio" und kein konzertsaal, oder?
mein onkel günther war kunstmaler und graphiker, desen haus ist jetzt auch ein museum und man hat vieles so gelassen wie es ist.
aber die besucher fassen nicht die schablonen an und bekommen von einem kunstexperten live vorgeführt, wie man eine staffelei aufstellt oder wie man eine farbtube aufdreht.
das weiß doch jeder, der in so ein haus zu besuch kommt.
Lauflicht
TR4ever
Dirk
|||||||||||
Noch besteht die Möglichkeit, einen Zeitzeugen zu befragen und das Ganze zu dokumentieren.
Gottfried Michael Koenig (* 5. Oktober 1926 in Magdeburg) ist ein deutscher Komponist.
Von 1954 bis 1964 war er Mitarbeiter im Studio für Elektronische Musik des NWDR (später WDR) in Köln und arbeitete mit Karlheinz Stockhausen und vielen anderen in- und ausländischen Komponisten zusammen. In diese Periode fallen auch Lehraufträge an der Musikhochschule Köln (elektronische Musik, Komposition, Analyse) und die Komposition von elektronischer Musik (Klangfiguren I/II, Essay, Terminus 1) und Instrumentalwerken (Klavierstücke, Holzbläserquintett, Streichquartett).
Quelle: Wikipedia
Gesang der Jünglinge im Feuerofen, meist auch offiziell nur als Gesang der Jünglinge bezeichnet, ist ein zentrales Frühwerk des Komponisten Karlheinz Stockhausen. Das Werk war bedeutend für die Entwicklung der elektronischen Musik. Es entstand 1955–56 im Studio für Elektronische Musik am Westdeutschen Rundfunk in Köln. Es wurde zusammen mit Gottfried Michael Koenig realisiert und am 30. Mai 1956 in Köln uraufgeführt. Die 5-Kanal-Komposition dauert 13 Minuten. Die Vokalpartien sang der damals zwölfjährige Josef Protschka.
Quelle: Wikipedia
Herr Müller kennt die Dinge nur mittelbar aus der entsprechenden Literatur, außerdem ist er Toningenieur und kann nach eignere Aussage zu den Gedankenkengängen der Pioniere der Elektronischen Musik nichts beitragen. Seine Vorführungen zu den damaligen Verfahren der Klanggewinnung und Klanggestaltung sind größtenteils falsch, obwohl dazu entsprechende Literatur im Bücherregal vorhanden ist. So trägt sich vermeindliches Fachwissen weiter.
Gottfried Michael Koenig (* 5. Oktober 1926 in Magdeburg) ist ein deutscher Komponist.
Von 1954 bis 1964 war er Mitarbeiter im Studio für Elektronische Musik des NWDR (später WDR) in Köln und arbeitete mit Karlheinz Stockhausen und vielen anderen in- und ausländischen Komponisten zusammen. In diese Periode fallen auch Lehraufträge an der Musikhochschule Köln (elektronische Musik, Komposition, Analyse) und die Komposition von elektronischer Musik (Klangfiguren I/II, Essay, Terminus 1) und Instrumentalwerken (Klavierstücke, Holzbläserquintett, Streichquartett).
Quelle: Wikipedia
Gesang der Jünglinge im Feuerofen, meist auch offiziell nur als Gesang der Jünglinge bezeichnet, ist ein zentrales Frühwerk des Komponisten Karlheinz Stockhausen. Das Werk war bedeutend für die Entwicklung der elektronischen Musik. Es entstand 1955–56 im Studio für Elektronische Musik am Westdeutschen Rundfunk in Köln. Es wurde zusammen mit Gottfried Michael Koenig realisiert und am 30. Mai 1956 in Köln uraufgeführt. Die 5-Kanal-Komposition dauert 13 Minuten. Die Vokalpartien sang der damals zwölfjährige Josef Protschka.
Quelle: Wikipedia
Herr Müller kennt die Dinge nur mittelbar aus der entsprechenden Literatur, außerdem ist er Toningenieur und kann nach eignere Aussage zu den Gedankenkengängen der Pioniere der Elektronischen Musik nichts beitragen. Seine Vorführungen zu den damaligen Verfahren der Klanggewinnung und Klanggestaltung sind größtenteils falsch, obwohl dazu entsprechende Literatur im Bücherregal vorhanden ist. So trägt sich vermeindliches Fachwissen weiter.
Zuletzt bearbeitet:
Dirk
|||||||||||
Der Mehrkanal Aufbau ist hier aber zurecht ein wichtiges Argument. Viele Kompositionen sind nämlich darauf ausgelegt. Dh zuhause kann man die Stücke garnicht so abhören wie vom Komponisten vorgesehen!
Daher empfnd ich es bei meinen mehrfachen Besuchen bemerkenswert, dass die Musikbeispiele bei den meisten Besuchern wenig bis kein Interesse hervorgerufen hatten, man quatschte einfach unsensibel dazwischen oder ging raus eine paffen.
Bernie
|||||||||||||||
Niemand wird gezwungen "auf dem Nagel" zu sitzen.Daher empfnd ich es bei meinen mehrfachen Besuchen bemerkenswert, dass die Musikbeispiele bei den meisten Besuchern wenig bis kein Interesse hervorgerufen hatten, man quatschte einfach unsensibel dazwischen oder ging raus eine paffen.
Dann lernt er halt nix, auch gut.
Ähnliche Themen
A
- Antworten
- 25
- Aufrufe
- 5K
Z
A
- Antworten
- 10
- Aufrufe
- 2K
A
News
-
Neutral Labs – Name noch geheim 👀 - AND/XOR-Patch-Routen, Shift Register, Mixer + FX, Mini-Display
- Gestartet von Moogulator
- Antworten: 1
-
News TR-808 zu gewöhnlich und öde? SequencerTalk 269 startet heute 20:30 Live
- Gestartet von Moogulator
- Antworten: 1
-
2026-03-21 Dortmund - No Limits No Control - Mit Nullvektor (D), Frett (PL), Incendie (F), Persons Unknown (D),Moogulator (D)
- Gestartet von Moogulator
- Antworten: 1
-
News Behringer vs. Frap Tools - Kontrastprogramm - heute live im SequencerTalk Live 268
- Gestartet von Moogulator
- Antworten: 1
-
News Nativer Schrecken! - SequencerTalk 267 - Was nach der großen Flut passiert
- Gestartet von Moogulator
- Antworten: 2
-
News Morbid - 32 Tracks mit dem Ziel maximal morbid zu klingen…
- Gestartet von Moogulator
- Antworten: 2
-
2026-01-31 Düsseldorf Die Vierte Kränkung / Willi Sauter (Klangbau Köln)
- Gestartet von Moogulator
- Antworten: 1
App installieren
So wird die App in iOS installiert
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
