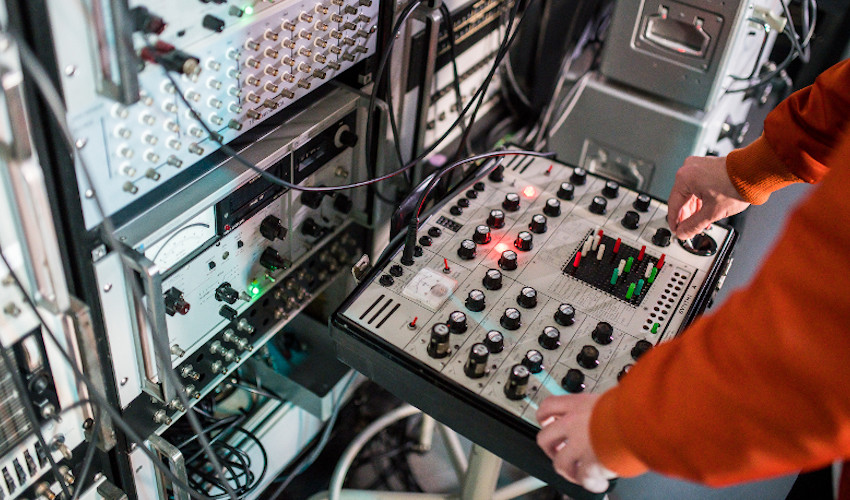Schnuffi
|||||||||||
Das erste Beispiel zeigt folgendes: Aus einer dichten Schar von mehr oder weniger undefinierbaren Tönen schießt ein Klang heraus, der 169 Hertz hat.rythmus lehnt er ja eh ab, kann also gar nicht sein.
Wir hören also ungefähr das kleine >Es<. Er schießt heraus und hat solch eine Klangfärbung [imitiert mit Stimme], fällt herunter in mehreren Kurven und zerbricht förmlich vor unseren Ohren, weil er durch die Wahrnehmungsgrenze schießt zwischen 30 und 16 Hertz; von 169 Hertz fällt er ungefähr 7 Oktaven 'runter. Das sind ungefähr vier Oktaven tiefer als das Klavier! Mit anderen Worten: die ursprünglichen Perioden hört man nicht mehr als Tonhöhen. Aber irgendetwas hört man ja doch noch: die Impulse, in die sich der konstante Ton zerlegt hat, haben auch noch eine Tonhöhe. Ich habe das ziemlich raffiniert gemacht, daß die Tonhöhe, auf der man landet, wieder dieselbe Tonhöhe ist, wie diejenige, mit der es begonnen hat, obwohl man 7 1/2 Oktaven gefallen ist.
Das muß man erläutern. Der erste Ton hatte eine Klangfarbe, bestimmte Teiltöne oder Obertonkomponenten, und diese Klangfarbenkomponenten sind, nachdem der Ton 7 1/2 Oktaven tiefer gefallen ist und sich in Einzelimpulse aufgelöst hat, jetzt als Tonhöhenkomponenten zu hören. Diese Tonhöhe stammt von den vorherigen als Klangfarbe gehörten Teilkomponenten der ersten Tonhöhe. So kann man 7 1/2 Oktaven fallen und genau dort ankommen, von wo man ausgegangen ist. Und das hat oft sichtbar und auch hörbar bei Leuten merkwürdige Gefühle im Magen hervorgerufen. Es liegt einfach daran, daß man eben dort eine kritische Zone durchfährt, wo man das akustische Gleichgewicht verliert. Das ist so ähnlich, wie wenn man für einen kurzen Moment in einen gravitationslosen oder orientierungslosen Raum kommt. Man verliert das Gleichgewicht, und der Körper und die Psyche reagieren sofort, um die Balance wiederzufinden, und zeigen entsprechende Symptome. So etwas geschieht immer dann, wenn man durch solche kritischen Zonen fährt, die Niemandsland sind. Die sind weder Tonhöhen noch Zeitdauern. Man kann sie noch nicht als Rhythmus hören, man kann sie aber auch nicht mehr als Tonhöhe hören. Das entspricht den tiefen Knacken bei Orgeln zum Beispiel, wenn die Tonhöhe so tief ist, daß das ganze Gehäuse zu scheppern anfängt und schließlich auch die Lampen im Raum mitklirren. Was also zwischen ca. 12 Impulsen pro Sekunde und 30 Impulsen pro Sekunde ist, läßt uns die Orientierung verlieren. Das liegt an uns, nicht an dem Klang. Hören wir jetzt das Beispiel.
Klangbeispiel 1
Man kann so etwas künstlerisch mehr oder weniger artikulieren; also mehrmals hinunter- und wieder hinaufgehen, die Einzeltöne länger machen und dann zum Beispiel wieder auf einen kontinuierlichen Ton kommen, der vorher auch schon da war, und dann mit diesem Ton weiter arbeiten. Man kann also innerhalb eines musikalischen Prozesses solch einen phänomenalen Vorgang sich ereignen lassen, der wie eine Öffnungsstelle wirkt, wo man auf einmal begreift, was eine Zeittransformation ist. Das physikalische Beispiel kann mehr oder weniger artikuliert werden, und das macht den wichtigen Unterschied zwischen Beispielen in der Physik und in der Musik aus.
Man kann bestimmte Kriterien auf ziemlich simple und banale Weise musikalisch klarmachen, oder aber sie irgendwie so komponieren, wie es noch keiner gemacht hat, also sehr eigenartig und unerwartet. Dann wird es Musik, dann wird es etwas Künstlerisches. Im übrigen aber ist es nichts anderes als eine Öffnung und eine Erweiterung des Bewußtseins. Auf einmal ist man nicht mehr derselbe, wenn man begriffen hat, daß Töne ja nur innerhalb eines bestimmten Prozesses so sind, wie sie scheinen; daß ich aus jedem Ereignis irgend etwas anderes machen kann, also aus einer Tonhöhe einen Rhythmus, aus einem Rhythmus eine formale Einteilung, aus einer formalen Einteilung eine Klangfarbe; daß man also kontinuierlich durch die musikalischen Wahrnehmungskategorien hindurchkomponieren kann.
Und das ist eigentlich das Wesentliche, was in der neuen Musik stattgefunden hat im Vergleich zur alten Musik. Alte Musik - eine Perspektive. Man hatte eine Orientierung: so, jetzt höre ich rhythmisch-metrisch, und das Harmonisch-Melodische gehört dazu, aber in eine andere Kategorie, das Dynamische wieder in eine andere Kategorie. Man hatte immer das Problem, diese Kategorien zusammenzubringen, statt von einer einheitlichen Konzeption auszugehen und die Vielfältigkeit aus der einheitlichen Konzeption heraus zu entfalten und zu entwickeln. Das Podest ist umgestürzt. Der ganze Kompositionsprozeß ist umgekehrt worden und damit auch die Wahrnehmung.
Die eine Perspektive ist durch Relativität zu einer Vieldimensionalität geworden. Was Rhythmus ist, ist unter Umständen gar kein Rhythmus, oder ist so gestaucht, daß er plötzlich eine Melodie, ein melodisches Phänomen wird, oder ein Klangfarbenphänomen. Und dieses kontinuierliche Übergehen von einer Perspektive in eine andere während ein- und desselben Stückes: das ist eigentlich das Thema des Komponierens geworden. Nicht mehr irgend etwas anderes zu komponieren oder darzustellen oder zu exemplifizieren oder zu konstruieren, sondern die Transformationsmöglichkeiten der Klangmaterie sind das Thema selbst.
Ständig komponiere ich multidimensionale Aspekte des Klanglichen, um denjenigen, der das erlebt, auch multidimensional zu machen oder werden zu lassen, ihm jedenfalls die Chance zu geben, daß er nicht mehr nur eine Perspektive hat, sondern sich mit den Veränderungen mitverändert. Daß er sich sozusagen auf den Klang draufsetzt und mit dem Klang bewegt, und wenn der Klang eine Dimension durchschießt und in eine andere Dimension hineinspringt, muß man selber diesen Wahrnehmungssprung mitmachen.
Vier Kriterien der Elektronischen Musik von Karlheinz Stockhausen
Die vier Kriterien der Elektronischen Musik von Karlheinz Stockhausen
www.elektropolis.de